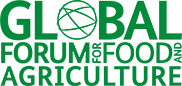Bei diesem Kurzvortrags-Wettbewerb wurden vier zehn-minütige Science Slam-Vorträge zum diesjährigen GFFA-Thema „Nachhaltige Landnutzung: Ernährungssicherung beginnt beim Boden“ vorgestellt.
Im Anschluss an die Slam-Vorträge entschied das internationale Publikum, an wen die GFFA Science Slam – Trophäe 2022 vergeben wurde. Nach der Siegerehrung hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer in sogenannten „Deep Dives“, separaten virtuellen Räumen, die Gelegenheit zum Austausch mit den Slammerinnen und Slammern.
Die Veranstaltung fand in englischer Sprache statt.

Wenn Insina nicht gerade mit ihrer personalisierten CD „Gute Nacht Schlaflieder für dich“ kleine und große Menschen in den Schlaf singt, reist sie mit Konzertprogrammen durch die Lande.
Seit 12 Jahren ist sie die Organisatorische und Künstlerische Leitung der „Klassenreisen zur Musik“ der Stiftung Kinder brauchen Musik von Rolf und Monika Zuckowski und studiert mit 80 Kindern Minimusicals ein.
Der einzige plattdeutsche Beschwerdechor „Meckerkring“ unter ihrer Leitung und Regie ist mit unterschiedlichen Chorformaten unterwegs.
Sie moderiert Wissenschaftkommunikationsformate wie den Science Slam in Hamburg und Berlin oder unterschiedlichste Veranstaltungen und Events.
Mit Annie Heger zusammen ist sie „Die Deichgranaten“, die mit einem Musikkabarettistischen Programm touren und auf Youtube mit plattdeutschen Tutorials, sogenannten „Verklarials“ zu sehen sind.
Im kommenden Jahr feiert auch ihr Soloprogramm als Singer-Songwriterin „Alles jetzt“ Premiere.
Ihr erster Song erschien im Januar 2021.
Webseite: www.insina.de
Über das große Interesse am Think Aloud! GFFA Science Slam haben wir uns sehr gefreut und bedanken uns für die Bewerbungen aus aller Welt. Aus der großen Anzahl an Interessierten wurden diese vier Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt:

Anzahl an Insekten es dort gibt und welchen Einfluss deren Ökosystem-Leistungen auf die Lebensmittelproduktion haben. Wir werden sehen, wie wir diese Insekten nutzen können, um unsere Lebensmittelproduktionssysteme durch die Sicherung des wichtigsten landwirtschaftlichen Produktionsfaktors – des fruchtbaren Bodens – an den Klimawandel anzupassen!
Zur Bodenfruchtbarkeit gehören Eigenschaften wie die organische Bodensubstanz, der Nährstoffumsatz, die Wasserspeicherfähigkeit, die Wasserversickerung und viele andere, die in einer durch Klimawandel und Bodendegradierung geprägten Zukunft zu immer wichtigeren Faktoren werden.
Bodenlebewesen können die Bodenfruchtbarkeit erhöhen und ermöglichen gegebenenfalls die Bewirtschaftung unwirtschaftlicher und degradierter Böden zu ermöglichen. Wir werden einige effiziente Strategien kennenlernen, die die bereits zur Verfügung stehenden integrierten Instrumente im Pflanzenbau und in der Tierzucht ergänzen können.

AUSZEICHNUNGEN UND PREISE

Aufgrund der zunehmenden Verschmutzung des Oberflächenwassers und der verstärkten landwirtschaftlichen Nutzung von Trockengebieten wird bereits jetzt – und auch perspektivisch – immer häufiger Grundwasser zu Bewässerungszwecken eingesetzt.
Bedauerlicherweise ist Grundwasser häufig in hohem Maße von natürlicher Verunreinigung durch Mineralstoffe betroffen.
Deren Extraktion und weitere Nutzung ist zu kostspielig oder hat aufgrund von Unzulänglichkeiten der verfügbaren Technologien erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Mithilfe unserer Technologie und des von uns entwickelten teilweise kreislaufwirtschaftlichen Systems der Abwasserextraktion und der weiteren stofflichen Verwertung als mineralische Zusatzstoffe im Nano- und Mikrozustand können wir negative Auswirkungen deutlich reduzieren und gleichzeitig mehr Bereiche für die nachhaltige Grundwassernutzung in der Landwirtschaft gewinnen.

Seite empfehlen
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.